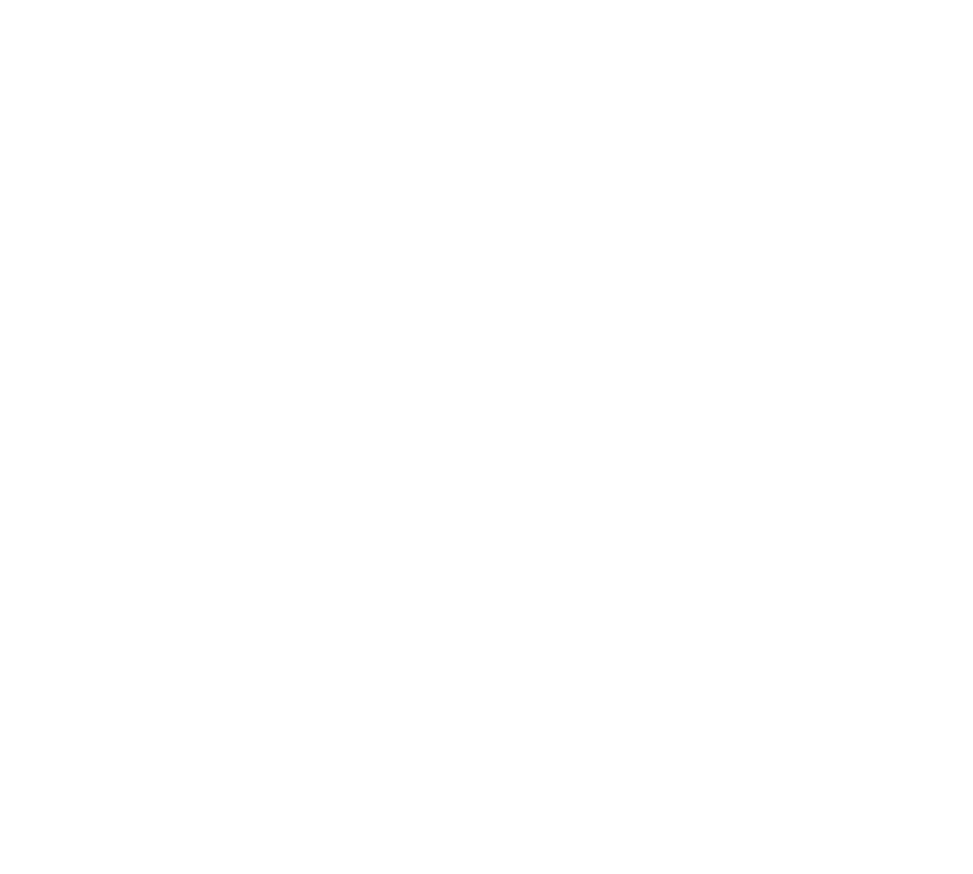
© Anton Prock 2013 - Impressum


Stifte des Barock und Rokoko in Tirol
Die mittelalterlichen Anlagen der religiösen Orden werden als Klöster bezeichnet. Grundlage dafür war der sogenannte Klosterplan von St. Gallen aus der Zeit um 820, der im 19. Jh. im Stift St. Gallen in der Schweiz gefunden wurde. Bei diesem Plan schloss der Kreuzgang an die Kirche an und vom Kreuzgang aus waren die anderen Räume zu erreichen.
Im Barock entstanden große und prächtig ausgestattete Anlagen, die in Österreich, der Schweiz und Süddeutschland als Stifte bezeichnet werden. In Nordtirol sind dies das Prämonstratenserstift Wilten, das Zisterzienserstift Stams und das Benediktinerstift Fiecht, in Südtirol das Benediktinerstift Marienberg südlich des Reschenpasses sowie die Augustiner-Chorherrenstifte Gries bei Bozen und Neustift bei Brixen.
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch der Bau der Jesuitenkirche (1627-1640) und des Jesuitenkollegs in der Universitätssstraße, des Servitenklosters in der Maria-Theresien-Straße (1613-1626) und des ehemaligen Ursulinenklosters am Markgraben und am Innrain (Johann Martin Gumpp d. Ä, 1700-1705).
Zisterzienserstift Stams
 1273 stifteten Elisabe
1273 stifteten Elisabe th von Bayern und ihr Gatte, der Tiroler Landesfürst Graf Meinhard
II., das Kloster Stams als Familiengrabstätte der Grafen von Görz-Tirol. Weiterer
Anlass für die Gründung war die Trauer Elisabeths über die Hinrichtung ihres Sohnes
Konradin aus erster Ehe, des letzten Hohenstaufers, in Neapel. 1284 erfolgte die
Weihe der romanischen Klosterkirche. Schwere Zeiten brachten die Bauernkriege und
die Plünderung durch die Truppen des Moritz von Sachsen im 16. Jh. In der Folge des
Brandes von 1593 entstand zwischen 1607 und 1635 eine neue Anlage. 1670 und 1689
verursachten heftige Erdbeben auch in Stams große Schäden. Die Innsbrucker Hofbaumeister
Johann Martin Gumpp d. Ä. und Georg Anton Gumpp gestalteten die Pläne für einen Um-
bzw. Neubau: neue Prälatur mit der markanten Doppelturmfassade (1692–1697), Heilig-Blut-Kapelle
(1715), Westtrakt mit Bernardisaal (1719–1721) und Umbau der romanischen Stiftskirche
(1729–1733). In der Stiftskirche schuf der Augsburger Johann Georg Wolcker die Deckenfresken
und der Wessobrunner
th von Bayern und ihr Gatte, der Tiroler Landesfürst Graf Meinhard
II., das Kloster Stams als Familiengrabstätte der Grafen von Görz-Tirol. Weiterer
Anlass für die Gründung war die Trauer Elisabeths über die Hinrichtung ihres Sohnes
Konradin aus erster Ehe, des letzten Hohenstaufers, in Neapel. 1284 erfolgte die
Weihe der romanischen Klosterkirche. Schwere Zeiten brachten die Bauernkriege und
die Plünderung durch die Truppen des Moritz von Sachsen im 16. Jh. In der Folge des
Brandes von 1593 entstand zwischen 1607 und 1635 eine neue Anlage. 1670 und 1689
verursachten heftige Erdbeben auch in Stams große Schäden. Die Innsbrucker Hofbaumeister
Johann Martin Gumpp d. Ä. und Georg Anton Gumpp gestalteten die Pläne für einen Um-
bzw. Neubau: neue Prälatur mit der markanten Doppelturmfassade (1692–1697), Heilig-Blut-Kapelle
(1715), Westtrakt mit Bernardisaal (1719–1721) und Umbau der romanischen Stiftskirche
(1729–1733). In der Stiftskirche schuf der Augsburger Johann Georg Wolcker die Deckenfresken
und der Wessobrunner  Franz Xaver Feuchtmayr den Stuck (1730-1734). Der frühbarocke
Hochaltar (1609-1613) von Bartlme Steinle aus Weilheim in Bayern ist in Form eines
Lebensbaumes mit 84 Skulpturen und Büsten gestaltet. Im hinteren Teil der Kirche
hat der Tiroler Andreas Thamasch 1681-1684 das Österreichische Grab mit Figuren verschiedener
Tiroler Landesfürsten errichtet, die hier bestattet sind. Auch die dramatisch bewegte
Kreuzigungsdarstellung über dem Grab stammt von Thamasch. In der an die Kirche anschließenden
Heilig-Blut-Kapelle (1715) befinden sich Fresken von Josef Schöpf (1800/1801). Zur
Stiftskirche hin ist die Kapelle durch ein kunstvolles Rosengitter (1716) von Bernhard
Bachnetzer abgeschlossen.
Franz Xaver Feuchtmayr den Stuck (1730-1734). Der frühbarocke
Hochaltar (1609-1613) von Bartlme Steinle aus Weilheim in Bayern ist in Form eines
Lebensbaumes mit 84 Skulpturen und Büsten gestaltet. Im hinteren Teil der Kirche
hat der Tiroler Andreas Thamasch 1681-1684 das Österreichische Grab mit Figuren verschiedener
Tiroler Landesfürsten errichtet, die hier bestattet sind. Auch die dramatisch bewegte
Kreuzigungsdarstellung über dem Grab stammt von Thamasch. In der an die Kirche anschließenden
Heilig-Blut-Kapelle (1715) befinden sich Fresken von Josef Schöpf (1800/1801). Zur
Stiftskirche hin ist die Kapelle durch ein kunstvolles Rosengitter (1716) von Bernhard
Bachnetzer abgeschlossen.
Ein prunkvoll gestaltetes Treppenhaus führt zum Festsaal, dem Bernardisaal (1719-1729). Die dortigen Fresken mit Szenen aus dem Leben des hl. Bernhard von Clairvaux malte 1721/1722 der Innsbrucker Hofmaler Franz Michael Hueber mit Hilfe von Anton Zoller.
Prämonstratenserstift Wilten
 Ab etwa 300 n. Chr. bestand in Wilten die römische Militärstation Veldidena. 1126
ließen sich Mitglieder des Prämonstratenserordens nieder. Beim heutigen Barockstift
handelt es sich um eine Anlage aus dem 17./18. Jh. Christoph Gumpp schuf die
Ab etwa 300 n. Chr. bestand in Wilten die römische Militärstation Veldidena. 1126
ließen sich Mitglieder des Prämonstratenserordens nieder. Beim heutigen Barockstift
handelt es sich um eine Anlage aus dem 17./18. Jh. Christoph Gumpp schuf die  Pläne
für die 1651-1665 errichtete Stiftskirche, Georg Anton Gumpp 1716 die vorgeblendete
Fassade, in der die beiden Riesen Haymon und Thyrsus stehen. Die Fresken von Kaspar
Waldmann mit Szenen aus dem Leben der beiden Kirchenpatrone Stephanus und Laurentius
wurden großteils im Zweiten Weltkrieg zerstört und von Hans Andre 1952 neu gemalt.
Die Stiftsanlage wurde ebenfalls von Christoph Gumpp geplant. Zu besichtigen sind
einige barocke Räume, darunter das Vestibül (Fresko der Vision des hl. Norbert von
Xanten von Egid Schor, 1696), der Norbertisaal (Fresken mit Szenen aus dem Leben
des hl. Norbert von Kaspar Waldmann, 1712), der Gartensaal (illusionistische Landschaftsdarstellungen
von Kaspar Waldmann (1710), die Bibliothek und einige Ausstellungsräume mit wertvollen
Kunstwerken.
Pläne
für die 1651-1665 errichtete Stiftskirche, Georg Anton Gumpp 1716 die vorgeblendete
Fassade, in der die beiden Riesen Haymon und Thyrsus stehen. Die Fresken von Kaspar
Waldmann mit Szenen aus dem Leben der beiden Kirchenpatrone Stephanus und Laurentius
wurden großteils im Zweiten Weltkrieg zerstört und von Hans Andre 1952 neu gemalt.
Die Stiftsanlage wurde ebenfalls von Christoph Gumpp geplant. Zu besichtigen sind
einige barocke Räume, darunter das Vestibül (Fresko der Vision des hl. Norbert von
Xanten von Egid Schor, 1696), der Norbertisaal (Fresken mit Szenen aus dem Leben
des hl. Norbert von Kaspar Waldmann, 1712), der Gartensaal (illusionistische Landschaftsdarstellungen
von Kaspar Waldmann (1710), die Bibliothek und einige Ausstellungsräume mit wertvollen
Kunstwerken.
Benediktinerstift St. Georgenberg-Fiecht
 Um 950 gründete der bayerische Adelige Rathold von Aibling im Stallental nördlich
von Schwaz eine klösterliche Gemeinschaft. Die erste Kirche war dem hl. Georg geweiht.
1138 übernahmen die Benediktiner das abgelene Kloster. Zu Beginn des 18. Jh. beschlossen
die Mönche nach vier Bränden die
Um 950 gründete der bayerische Adelige Rathold von Aibling im Stallental nördlich
von Schwaz eine klösterliche Gemeinschaft. Die erste Kirche war dem hl. Georg geweiht.
1138 übernahmen die Benediktiner das abgelene Kloster. Zu Beginn des 18. Jh. beschlossen
die Mönche nach vier Bränden die Verlegung des Klosters ins Inntal und ließen zwischen
1706 und 1750 gegenüber von Schwaz ein typisch barockes Stift mit Kirche erbauen.
Die Stiftskirche (1741-1750) wurde vom Schwazer Baumeister Jakob Singer errichtet
und mit Fresken des Augsburgers Matthäus Günther ausgestattet. Es handelt sich um
Szenen aus dem Leben des hl. Josef und der hl. Maria.
Verlegung des Klosters ins Inntal und ließen zwischen
1706 und 1750 gegenüber von Schwaz ein typisch barockes Stift mit Kirche erbauen.
Die Stiftskirche (1741-1750) wurde vom Schwazer Baumeister Jakob Singer errichtet
und mit Fresken des Augsburgers Matthäus Günther ausgestattet. Es handelt sich um
Szenen aus dem Leben des hl. Josef und der hl. Maria.
Zum Stift gehören die Wallfahrtskirche und das Wallfahrtskloster St. Georgenberg im Stallental, rund 1,5 Gehstunden von Fiecht entfernt. Die barocke Kirche stammt von Jakob Singer (1733-1738).
| Überblickstext |
| Franz Stephan |
| Übersicht |
| Erziehung |
| Überblickstext |
| Überblickstext |
| Überblick |
| Barock-Rokoko |
| Klassizismus |
| Klöster und Stifte |
| Schlösser-Palais |
| Freskomalerei |
| Tirol |
| Kirchenarchitektur |
| Stiftsarchitektur |
| Weltliche Architektur |
| Plastik |
| Stuck |
| Malerei |
| Baugeschichte |
| Hochzeit 1765 |
| Tod des Kaisers - 1765 |
| Räume |
| Triumphpforte |
| Adeliges Damenstift |